Schwarze Wut und Braune Scheiße
Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche
Mitmenschen können so nervend sein. Hier in Deutschland genau wie anderswo. Allein die Diskussion um das Wort „Neger“! Eigentlich ganz einfach: Wenn sich Menschen, die damit beschrieben werden, von dem Wort herabgewürdigt sehen, verzichte ich doch schon aus Gründen der Höflichkeit darauf. Es sei denn, ich beabsichtige diese Herabwürdigung.
Statt dessen: Das ewig gleiche Gejammer, man würde dem Sprecher seine Sprache verbieten. Verboten wird gar nix. Nur darauf hingewiesen, dass dem Wort eine pejorative Bedeutung eignet.
Oder die immer wieder gleichen Diskussionen um jenes Gebäck. Keine Ahnung, wieso man es „Negerkuss“ genannt hat. „Schokokuss“ ist auch nicht gerade eine Beschreibung. Dann eher schon „Superdickmann“. Denn es macht ja wirklich super dick, Mann!
Wenn einem Kindeswohl am Herzen liegt, sollte man es, statt es zu essen, lieber wegwerfen. Genau das geschieht in unserer Wohlstandsgesellschaft zur Belustigung der Kinder bei den Schulfeiern. Der Vorgang heißt dort „Negerkussweitwurf“. Oder, noch drastischer: „Mohrenkopfweitwurf“. Warum das sein muss? Nun, hier bei uns sage man das eben so. Und da ich nicht per Inzucht in dieser Kleinstadt gezeugt wurde, habe ich, als ein erst seit 15 Jahren Ansässiger, offenbar schlichtweg kein Stimmrecht.
Nun hat die Schule einen neuen Direktor, dem der Blödsinn offenbar auch aufgefallen ist. Endlich.
Wie führt nun die alte Lehrkraft den Wettbewerb ein? „Nachher findet ein Schokokussweitwurf statt.“ Um nach einer kleinen verschämten Pause, in der das Unwohlsein über die offenbar aufoktroyierte Sprache in ihr wühlt, mit einnehmender Geste in ebenso einnehmender Halbmundart fortzufahren: „Frieher hammar halt Negerkuss gesoacht“. Der Satz soll wie eine Befreiung wirken und tatsächlich erntet sie das beabsichtigte Underdog-Gelächter des weißen Prekariats.
Nein. Da verstehe ich Frau Eddo-Lodge: Irgendwann verliert man die Lust auf die ewig gleichen Diskussionen mit der intellektuellen Bestandslage. Und irgendwann ist auch das letzte meiner Kinder aus der Gegend weggezogen, um in urbaner Umgebung weniger Dauerverletzungen ausgesetzt zu sein.
Oder: Warum müssen wohlmeinende Frauen die elementarsten Persönlichkeits- und Abstandsregeln verletzen und wildfremden Kindern wie Erwachsenen „einfach mal über diese schwarzen Haare streicheln“? Eine archaische Form des Be-Greifens? Ich streichel doch auch nicht mit der Begründung über ihre Brust, dass ich nur so die ganze Schönheit wohlmeinend begreifen könne? Feminismus wird langsam kapiert. Rassismus noch lange nicht. Auch in diesem Punkt gehe ich mit Frau Eddo-Lodge d‘accord.
Ihr Buch weist eine ganze Reihe weiterer Qualitäten auf:
– Streiflichtartig hat sie eine Geschichte der schwarzen Briten angerissen, und damit den Betreffenden ermöglicht, ihr Selbstwertgefühl nicht nur über die Geschichte amerikanischer Bürgerrechtsbewegung zu definieren. So etwas fehlt hier in Old Germany. Natürlich auch, weil schwarze Immigration hier bedeutend geringer ausfiel.
– Eines ihrer Hauptanliegen ist die Darstellung strukturellen Rassismus: In der englischen Gesellschaft haben Weiße schon deshalb einen statistisch quantifizierbaren Vorteil, weil sie Weiße sind. Das belegt sie sehr gut. Sie fordert nun von den Weißen, sich bei allen diesbezüglichen Diskussionen und Entscheidungen dieses Privilegs zumindest bewusst zu werden und es perspektivisch abzuschaffen.
– In eigener Sache thematisiert sie die Problematik gemischtrassischer Kinder zwischen den Welten ihrer schwarzen und weißen Familienhälfte. Und die Thematik schwarzer adoptierter Kinder in rein weißer Umgebung. Meines Erachtens kommt dieser wichtige Punkt sehr kurz geschnitten rüber. Es wäre ein durchaus lohnenswerter Ansatz, diese Fragen breiter anzugehen, denn hier wird das private politisch und das politische privat.
– Neben den Kategorien „Schwarz“ und „Frau“, spricht sie auch die Kategorie „Klasse“ an. Für das Zusammenspiel der verschiedenen Kategorien findet sie in Aufnahme eines Bildes von Angela Davis im Muster von künstlich angelegten Städten mit ihren parallel angelegten Straßen und deren Kreuzungen eine gelungene Parabel.
Wobei sie aber auch mit der BBC übereinstimmt, dass statt der traditionellen Dreiteilung (Ober-, Mittel-, Unterschicht) heute lediglich eine Fünfteilung sinnvoller sei. Andererseits entwertet sie diese Kategorien gleich wieder, indem sie entgegen den von ihr selbst vorgebrachten Zahlen, suggeriert, dass Schwarze vor allem die Unterklasse prägen würden. Tatsächlich gilt das wohl eher für die zweitunterste Klasse: Schlimmer geht immer.
Hier wäre auch der erste Punkt, bei dem ich ihr vehement widersprechen würde: Die aktuellen Verteilungskämpfe der gesellschaftlichen Ressourcen sind nur scheinbar zwischen Frau und Mann, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arbeiter, Unternehmer und Beamten.
Statt auf eine wirkliche Umverteilung von Oben nach Unten zu drängen, zerfleischen wir uns wegen der Brotkrumen. Der fleißige Handwerker, die überforderte allein erziehende Verkäuferin, der eher gemächliche Berufshartzer und der aus seinem Leben geschleuderte Flüchtling gönnen einander die Brotkrumen nicht, die von den wirklich Reichen übrig gelassen werden.
Ein weiterer Blick über den Tellerrand britischer (respektive europäischer) Verhältnisse sollte Eddo-Lodge ebenfalls zur Erkenntnis reichen: Die Diskrepanz zwischen den Untersten und den Obersten ist in einigen afrikanischen Staaten so viel gewaltiger als hierzulande. Und dort sind die Herrscher keine alten weißen Männer sondern alte schwarze Männer. Und oft genug agieren dahinter ihre alten oder jungen schwarzen Frauen.
Größere Ungerechtigkeiten in der Chancenverteilung und in der Verteilung des Reichtums und der Macht sind schlimm, weil sie den Charakter des Menschen korrumpieren. Nicht nur den des Betroffenen, sondern auch den des scheinbaren Siegers beim Verteilungskampf: Er bekommt ein falsches Bild von sich. Er meint, sein Erfolg sei allein sein eigener Verdienst und sieht auf die weniger Erfolgreichen herab. Damit verletzt er nicht nur andere, sondern verliert an eigener menschlicher Qualität. Vor Jahrzehnten haben das mal ein paar so genannte Befreiungstheologen thematisiert. Hat aber auch nichts genützt: Entweder sind sie getötet worden, oder sie wurden ausgeknockt. Oder sie haben sich ins System etabliert und waren dann ganz schnell selbst korrumpiert – wie Jean Bertrand Aristide. Die Chance, das zu verstehen, vertut Reni Eddo-Lodge ohne Grund und kommt so ganz nebenher zu einem sehr fragwürdigen Verständnis von Yin und Yang (S. 125)
Frau Eddo-Lodge fordert immer wieder von Weißen, sich ihrer einfach schon durch Hautfarbe festgesetzten Privilegien bewusst zu werden, und von Schwarzen, diese zu erobern. Das hat Herr Aristide z.B. ja damals durchaus getan. Der Erfolg: Es ging fortan anderen gut und anderen schlecht. Und sowohl auf der Gewinner- als auch auf der Verliererseite standen in Haiti vorher und nachher wenig Weiße und viele Schwarze. Noch weniger lassen sich System und Forderung der Autorin auf die Verhältnisse z.B. in Mosambik anwenden.
Sie ist demzufolge da am Besten, wo durch ihre Texte wenigstens hindurchschimmert, dass die Verhältnisse als solche anfragbar seien. Schade, dass sie da nicht tiefer bohrt.
Der Feminismus hat dazu geführt, das Frauen Staatsoberhäupter, Konzernchefs und vielleicht auch irgendwann Papst sein können. Hat das irgendetwas an der Struktur geändert? Ist die Welt dadurch humaner, friedlicher oder auch nur kinderfreundlicher geworden?
Der letzte deutsche Kanzler, unter dem keine deutschen Soldaten in Kriege verwickelt waren, war ein Mann: Helmut Kohl. Als sein Nachfolger, Gerhard Schröder im Irak nicht mit Krieg spielen wollte, setzte sich dessen spätere Nachfolgerin, Angela Merkel, sehr für eine Teilnahme ein. Die letzten beiden großen Kriegseinsätze der Briten teilen sich Margret Thatcher mit dem Falklandkrieg und Tony Blair mit dem Irakkrieg schwesterlich.
Die Vertreibung der Rohingya geschah unter der Ägide der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.
Teilhabe an den Privilegien durch Frauen hat die Welt nicht wirklich besser gemacht. Genau so wenig wird sie besser durch die Teilhabe von Schwarzen.
Wenn man also gegen strukturellen Rassismus vorgeht, ist das richtig und gut. Das durchaus lohnenswerte Ziel ist Chancengleichheit, die sich auch statistisch darstellen lässt. Eine bessere Welt aber wird dadurch nicht entstehen. Die Macht wird nur durch andere, nicht durch Bessere, ausgeübt werden.
Sprache ist nicht nur zur Verständigung wichtig. Sie wirkt auch als Schwert: Wir können mit ihr andere verletzen und töten. Sie ist aber auch ein Schild – und zwar im doppelten Sinne: Wir können uns hinter ihr verstecken und gleichzeitig mit ihr Botschaften transportieren.
Wie nennt man Nicht-Weiße, wenn man sie nicht indirekt definieren möchte? Ich habe mich hier und anderswo für „Schwarze“ entschieden, weil das am ehesten dem entspricht, wie sich meine diesbezüglichen Verwandten und Bekannten bezeichnen, auch wenn ihre Haut hell scheint und die Haare auch Jung-Siegfried eignen könnten.
„Farbige“ wird nicht von allen als angenehme Bezeichnung empfunden. „Menschen mit Migrationshintergrund“ ist umständlich und gestelzt und trifft auch auf die Kowalskis und Schimanskis zu, ja auch auf gewisse Österreicher, die wir eingedeutscht haben. Und die waren und sind meistens alle ziemlich weiß.
Die deutsche Übersetzung von Frau Eddo-Lodges Buch schwankt da gewaltig, wobei noch ein paar englische Spezialausdrücke wie „BME“ und das unsägliche „People of Colour“ hinzukommen.
Vielleicht verstecke ich ja auch die Schwierigkeit von Bezeichnung und Zuordnung hinter dem einfachen „Schwarz“. Wenn jemand ein besseres Angebot hat – nur zu!
Ähnliches gilt für den Begriff des Rassismus überhaupt. Ich mag ihn nicht, weil er die Begrifflichkeit des wissenschaftlichen Irrtums aufgreift, dass es bei den Menschen verschiedene Rassen gäbe. Es ist die Wortwahl der alten Spalter, die die Menschen in Rassen einteilten, um einen Teil davon unterdrücken zu können. Auch hier ist eigentlich ein neuer Begriff gefragt, der nicht die Terminologie dieses Irrtums zementiert.
Viele andere Kommentatoren finden das Buch von Frau Eddo-Lodge gelungen und preisen es in hohen und höchsten Tönen. Dem kann ich mich nicht anschließen. Es ist formal ziemlich zusammengestoppelt. Eine klare Begrifflichkeit zieht sich – wenigstens in der deutschen Ausgabe – ebensowenig durch wie eine nachvollziehbare Struktur. Daran mag die Herkunft eine gewisse Mitschuld tragen: Wenn man den Diskurs in den jeweiligen Blogs, Chats, Talkshows, Twitter- und Facebookbeiträgen als geisteswissenschaftliche Arbeit versteht, ist man von einem Geschwurbel nicht mehr allzufern, dass, je nach Gesprächspartner, Positionen verwischt und Missverständnisse zu Themen uminterpretiert.
Trotzdem hat dieses Buch in Großbritannien innerhalb gewisser Zirkel eine wichtige Debatte entfacht und wird deshalb auch nicht zu Unrecht gerühmt. Es war einfach der richtige Input zum richtigen Zeitpunkt und da darf auch mal auf den Luxus stringenter Gedankenführung verzichtet werden.
Schaut man mal in die andere Filterblase hinüber, so wird dem Buch „umgekehrter Rassismus“ (was immer das nun wieder sein mag – gemeint ist wohl eine beabsichtigte Benachteiligung von Weißen) vorgeworfen. Um diesen Vorwürfen im Vorfeld den Wind aus den Segeln zu nehmen, versucht sich Frau Eddo-Lodge in dem, was sie von den Weißen verlangt: Dem Bewusstmachen der eigenen Privilegien. Dabei vergisst sie in ihrer eurozentrischen Sicht vielleicht ein paar der Wichtigsten: Sie ist nämlich in erster Linie genau das: Europäerin. Sie lebt in Frieden. Sie hat ausreichend Nahrung, Kleidung und Energie. Und damit ist sie gegenüber einem Großteil der Weltbevölkerung – genau wie ich – dermaßen privilegiert, dass wir unser Glück kaum fassen dürften. Natürlich können wir einerseits nach mehr Teilhabe an den Ressourcen derer streben, denen es wesentlich besser geht. Das wäre in jeder Hinsicht in Ordnung.
Wir könnten aber auch anders herangehen und überlegen, wie wir Ressourcen an die abtreten, denen es wesentlich schlechter geht.
Eines noch: Ob man das Buch mag oder nicht – es enthält auf jeden Fall eine Perle:
Das ist das Interview mit Nick Griffin von der British National Party.
Eddo-Lodge bezeichnet das Interview als surreal. Dem möchte ich widersprechen.
Es ist, im Gegenteil, sowas von real!
Gar nicht mal unintelligent nimmt Herr Griffin dort den Standpunkt der bedrohten Minderheit ein. Als seien seine weißen Briten ein seltene Art, die vom Aussterben bedroht ist und geschützt gehört. Der Witz: Hat man sich auf den Begriff und Standpunkt des Rassismus eingelassen – und das tut ja Frau Eddo-Lodge auch – so hat Herr Griffin nicht einmal Unrecht. Jeder Bergsalamander wird geschützt, warum nicht auch die selten werdende weiße „Rasse“ des Homo sapiens britannicae? Natürlich ist das kein origineller Standpunkt, man hört ihn ja in Europa allerorten. Aber ein Gespräch zwischen zwei Protagonisten verschiedener Lager findet so selten statt – da mag man beide wegen ihrer Bereitschaft gar nicht genug loben.
Und dann, nachdem über ein paar Seiten Argumente ausgetauscht wurden, die sich an den Regeln logischer Gesprächsführung orientierten, schwappt plötzlich auf die sehr offene Frage Eddo-Lodges, wo sie sich denn als Schwarze rein britischer Identität seiner Meinung nach verorten sollte, die fast lehrbuchhafte Antwort des alten weißen Mannes daher:
Das junge schwarze Ding möge sich doch ein Land suchen, das irgendetwas mit ihrem Erbe zu tun habe (das britische Erbe wird ihr damit abgesprochen) und dort Kinder werfen (offenbar statt sich am intellektuellen Diskurs zu beteiligen). Originell lediglich die Begründung:
„Denn Großbritannien steckt, um es unhöflich zu sagen, tief in der Scheiße.“
Da benennt die Ursache ihre Folgen mit Recht.
Tüchersfeld, den 07.04.2019
Reinhard W. Moosdorf
 Massenmörder, Auftragskiller, Folterer, Schreibtischtäter: Sie sind Lieblingsfiguren der Geschichtsschreibung, in Filmen und Literatur – sei es als Monster, unheimliche Doppelexistenz oder gottgleich verehrtes Leitidol. Und wenn eine Lichtgestalt auftritt, bedarf sie solcher Gegenspieler zum Sieg, zur Machtübernahme – das heißt dann „Happy End“.
Massenmörder, Auftragskiller, Folterer, Schreibtischtäter: Sie sind Lieblingsfiguren der Geschichtsschreibung, in Filmen und Literatur – sei es als Monster, unheimliche Doppelexistenz oder gottgleich verehrtes Leitidol. Und wenn eine Lichtgestalt auftritt, bedarf sie solcher Gegenspieler zum Sieg, zur Machtübernahme – das heißt dann „Happy End“.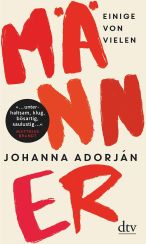 Die Journalistin und Schriftstellerin Johanna Adorján hatte bis Ende 2018 eine wöchentliche Kolumne mit dem schlichten Titel „Männer“ in der Süddeutschen Zeitung. Darin porträtierte sie alle möglichen Vertreter des männlichen Geschlechts: Prominente, ehemalige Liebhaber, Laute, Leise, Dumme, Witzige, Sympathische und sehr Unsympathische. Nun ist das Ganze als Buch erschienen.
Die Journalistin und Schriftstellerin Johanna Adorján hatte bis Ende 2018 eine wöchentliche Kolumne mit dem schlichten Titel „Männer“ in der Süddeutschen Zeitung. Darin porträtierte sie alle möglichen Vertreter des männlichen Geschlechts: Prominente, ehemalige Liebhaber, Laute, Leise, Dumme, Witzige, Sympathische und sehr Unsympathische. Nun ist das Ganze als Buch erschienen.


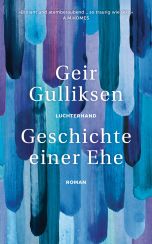 Der norwegische Autor Geir Gulliksen erzählt in seinem Roman „Geschichten einer Ehe“ vom langsamen Ende einer Beziehung. Jon und Timmy, die zwei gemeinsame Söhne haben, wollen eine moderne Ehe führen, die anders ist als andere. Sie soll frei von Eifersucht sein, jeder soll sich frei entfalten können. Dazu gehören auch Abenteuer mit anderen Geschlechtspartnern und der gegenseitige Austausch darüber.
Der norwegische Autor Geir Gulliksen erzählt in seinem Roman „Geschichten einer Ehe“ vom langsamen Ende einer Beziehung. Jon und Timmy, die zwei gemeinsame Söhne haben, wollen eine moderne Ehe führen, die anders ist als andere. Sie soll frei von Eifersucht sein, jeder soll sich frei entfalten können. Dazu gehören auch Abenteuer mit anderen Geschlechtspartnern und der gegenseitige Austausch darüber.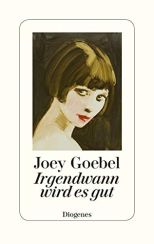 „Irgendwann wird es gut“ heißt die neue, sehr lesenswerte Geschichten-Sammlung des 1980 geborenen US-amerikanischen Autors Joey Goebel. Doch viele Figuren in diesem Buch, die alle in der fiktiven Kleinstadt Moberby leben, sind weit davon entfernt, ein Happy End zu erleben – wie Anthony in der allerersten Geschichte. Er ist verliebt in die Nachrichtensprecherin Olivia und hat jeden Abend Punkt 18 Uhr ein Rendezvous mit ihr, das er zelebriert: wenn sie auf der Mattscheibe erscheint und er auf dem heimischen Sofa sitzt.
„Irgendwann wird es gut“ heißt die neue, sehr lesenswerte Geschichten-Sammlung des 1980 geborenen US-amerikanischen Autors Joey Goebel. Doch viele Figuren in diesem Buch, die alle in der fiktiven Kleinstadt Moberby leben, sind weit davon entfernt, ein Happy End zu erleben – wie Anthony in der allerersten Geschichte. Er ist verliebt in die Nachrichtensprecherin Olivia und hat jeden Abend Punkt 18 Uhr ein Rendezvous mit ihr, das er zelebriert: wenn sie auf der Mattscheibe erscheint und er auf dem heimischen Sofa sitzt.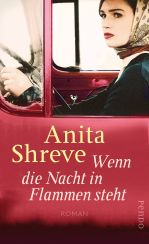 Den vielleicht etwas kitschigen Titel „Wenn die Nacht in Flammen steht“ trägt ein Buch aus Amerika, das gar nicht kitschig ist, sondern spannend und einfühlsam. Autorin Anita Shreve (1946 – 2018) schreibt über die junge Frau Grace, die 1947 in Hunts Beach/Maine mit Ehemann Gene und zwei kleinen Kindern in einem Häuschen am Meer lebt.
Den vielleicht etwas kitschigen Titel „Wenn die Nacht in Flammen steht“ trägt ein Buch aus Amerika, das gar nicht kitschig ist, sondern spannend und einfühlsam. Autorin Anita Shreve (1946 – 2018) schreibt über die junge Frau Grace, die 1947 in Hunts Beach/Maine mit Ehemann Gene und zwei kleinen Kindern in einem Häuschen am Meer lebt.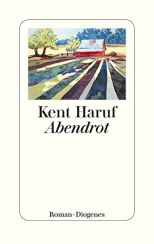 Im Schweizer Diogenes-Verlag ist dankenswerterweise ein Buch erschienen, das im amerikanischen Original „Eventide“ bereits seit 2004 existiert: „Abendrot“ von Kent Haruf.
Im Schweizer Diogenes-Verlag ist dankenswerterweise ein Buch erschienen, das im amerikanischen Original „Eventide“ bereits seit 2004 existiert: „Abendrot“ von Kent Haruf.
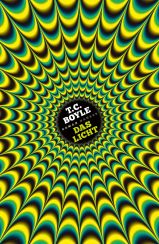 Für sein neuestes Werk „Das Licht“ bedient sich der US-amerikanische Kultautor T.C. Boyle einer Methode, die er bereits bei früheren Büchern angewandt hat: Er schreibt einen Roman rund um Geschehnisse, die sich wirklich ereignet haben.
Für sein neuestes Werk „Das Licht“ bedient sich der US-amerikanische Kultautor T.C. Boyle einer Methode, die er bereits bei früheren Büchern angewandt hat: Er schreibt einen Roman rund um Geschehnisse, die sich wirklich ereignet haben.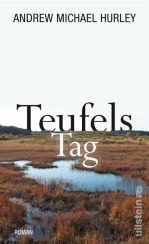 Atmosphärisch äußerst dicht präsentiert sich der Roman „Teufels Tag“ des britischen Autors Andrew Michael Hurley. Der Engländer entführt uns in die fast schon archaisch anmutende Welt einer Handvoll Bauern-Familien, die irgendwo in einer gottverlassenen Gegend am Rande einer Moorlandschaft ihr karges Dasein fristen.
Atmosphärisch äußerst dicht präsentiert sich der Roman „Teufels Tag“ des britischen Autors Andrew Michael Hurley. Der Engländer entführt uns in die fast schon archaisch anmutende Welt einer Handvoll Bauern-Familien, die irgendwo in einer gottverlassenen Gegend am Rande einer Moorlandschaft ihr karges Dasein fristen.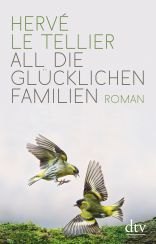 Der 1957 geborene französische Autor Hervé Le Tellier widmet sich in seinem neuen Buch „All die glücklichen Familien“ seiner Verwandtschaft. Auf dem Cover steht zwar „Roman“, aber eigentlich handelt es sich um eine Autobiographie, die sich kritisch vor allem mit seiner Mutter Marceline, seinem Stiefvater Guy und seinem leiblichen Vater Serge auseinandersetzt. Schon ein Buchzitat auf der Rückseite des Covers weist auf diese Stoßrichtung hin: „Mir war schon immer klar, dass meine Mutter verrückt ist.“
Der 1957 geborene französische Autor Hervé Le Tellier widmet sich in seinem neuen Buch „All die glücklichen Familien“ seiner Verwandtschaft. Auf dem Cover steht zwar „Roman“, aber eigentlich handelt es sich um eine Autobiographie, die sich kritisch vor allem mit seiner Mutter Marceline, seinem Stiefvater Guy und seinem leiblichen Vater Serge auseinandersetzt. Schon ein Buchzitat auf der Rückseite des Covers weist auf diese Stoßrichtung hin: „Mir war schon immer klar, dass meine Mutter verrückt ist.“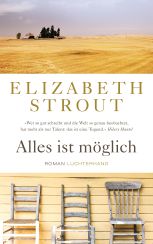 Die gesamte Bandbreite menschlicher Gefühle bildet die amerikanische Autorin Elizabeth Strout in ihrem neuesten Werk „Alles ist möglich“ ab: Hass, Liebe, Neid, Wut, Einsamkeit, Verbitterung und vieles mehr. Dabei ist der Text weniger ein Roman als vielmehr eine Geschichten-Sammlung, wobei die Menschen, die in den jeweiligen Abschnitten im Mittelpunkt stehen, sich mehr oder weniger kennen oder miteinander verwandt sind. Sie alle leben in oder um die (fiktive) amerikanische Kleinstadt Amgash in Illinois (USA), „einem Kaff zwischen Mais- und Sojabohnenfeldern“, wie es im Klappentext heißt.
Die gesamte Bandbreite menschlicher Gefühle bildet die amerikanische Autorin Elizabeth Strout in ihrem neuesten Werk „Alles ist möglich“ ab: Hass, Liebe, Neid, Wut, Einsamkeit, Verbitterung und vieles mehr. Dabei ist der Text weniger ein Roman als vielmehr eine Geschichten-Sammlung, wobei die Menschen, die in den jeweiligen Abschnitten im Mittelpunkt stehen, sich mehr oder weniger kennen oder miteinander verwandt sind. Sie alle leben in oder um die (fiktive) amerikanische Kleinstadt Amgash in Illinois (USA), „einem Kaff zwischen Mais- und Sojabohnenfeldern“, wie es im Klappentext heißt.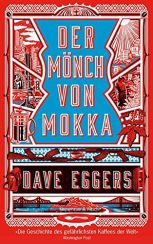 Dave Eggers‘ neuestes Buch ist kein Roman. Es ist vielmehr die äußerst spannende (bisherige) Lebensgeschichte von Mokhtar Alkhanshali. Der heute 30-jährige Amerikaner mit jemenitischen Wurzeln hat sich im Jahre 2013 in den Kopf gesetzt, Kaffee aus dem Jemen in die USA zu importieren.
Dave Eggers‘ neuestes Buch ist kein Roman. Es ist vielmehr die äußerst spannende (bisherige) Lebensgeschichte von Mokhtar Alkhanshali. Der heute 30-jährige Amerikaner mit jemenitischen Wurzeln hat sich im Jahre 2013 in den Kopf gesetzt, Kaffee aus dem Jemen in die USA zu importieren.