Sonntag, 05.04.2020
Autor: Andreas Schröter
Marion Messina: Fehlstart
 Einen hervorragenden Blick in das Innenleben (mutmaßlich) vieler jungen Menschen von heute gewährt uns die französische Autorin Marion Messina mit ihrem Debütroman „Fehlstart“.
Einen hervorragenden Blick in das Innenleben (mutmaßlich) vieler jungen Menschen von heute gewährt uns die französische Autorin Marion Messina mit ihrem Debütroman „Fehlstart“.
Die 19-jährige Aurélie setzt alles daran, dem Arbeitermilieu ihrer Eltern in Grenoble zu entfliehen. Doch das Leben nach der Schule entpuppt sich als schwierig. Eine erste Liebe, in die sie sich mit Haut und Haaren stürzt, scheitert. Aurélie flieht nach Paris, wo sie sich ein weltläufiges Bohème-Leben als Jura-Studentin erhofft. Doch leider empfindet sie die Seminare und Vorlesungen als tödlich langweilig – also sucht sie sich einen Job als Empfangsdame ohne wirkliche Aufgabe, der nicht minder öde ist.
Auch in der Liebe läuft es alles andere als rund. Aurélie schwankt zwischen dem Langweiler Franck und dem vom Leben enttäuschten Benjamin, der auf sie jedoch keinerlei erotische Ausstrahlung hat. Hinzu kommt die Schwierigkeit, in der Millionenstadt eine halbwegs bezahlbare Wohnung zu finden.
Marion Messinas Roman ist böse, düster, pessimistisch zynisch und sehr aktuell. Und er steckt voller Wahrheiten – zumindest für diejenigen Zeitgenossen, die sich mit dem Tunnelblick auf Karriere, Werbe-Glitzerwelt und Mainstream nicht zufrieden geben wollen: Twens mit guten Schulabschlüssen und allerlei sonstigen Qualifikationen beispielsweise, die als Pizzaboten oder ewig lächelndes Inventar hinter dem Tresen im Foyer eines Luxustempels versuchen müssen, irgendwie über die Runden zu kommen.
Oder wie Aurélies erste Liebe Alejandro, ein Kolumbianer, der sich weder in Frankreich, noch in Kolumbien heimisch fühlt. Sie alle sehnen sich genauso danach, die Großstadt auf ewig zu verlassen und ein Landleben zu führen wie sie Angst genau davor haben.
„Fehlstart“ ist ein unbedingt lesenswerter Roman, der von den Zerrissenheiten in vielerlei Hinsicht handelt, mit denen jüngere Menschen gerade in der heutigen Zeit zu kämpfen haben.
Marion Messina: Fehlstart.
Hanser, Januar 2020.
168 Seiten, Gebundene Ausgabe, 18,00 Euro.
Samstag, 04.04.2020
Autor: oliverg
Videoreview – Abbott: Flatland
Sponsoring
Werbung ermöglicht es unseren Autoren, live von Events zu bloggen und unsere Kosten zu decken. Für Ihr Unternehmen und Produkt bieten wir diverse Möglichkeiten sich darzustellen. Effektiv und Preiswert.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns!
Sonntag, 22.03.2020
Autor: Immo Sennewald
Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2020
 Aus dem Abstand von mehr als 30 Jahren erscheint unbegreiflich, dass viele Wirtschaftsexperten, Politiker, Journalisten und Historiker sich nach dem Zusammenbruch des osteuropäischen Sozialismus der Illusion hingaben, damit seien Marktwirtschaft, Kapitalismus, Freiheit und Demokratie auf dem Weg zum globalen Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Wurde der Aufstieg Chinas, seine Stellung in Südostasien, Ambitionen im pazifischen Raum und in Afrika unterschätzt, weil oder obwohl die Einparteien-Diktatur der KPCh während und nach dem Massaker des 4. Juni 1989 auf dem Tian’anmen ihren Machtanspruch demonstrierte?
Aus dem Abstand von mehr als 30 Jahren erscheint unbegreiflich, dass viele Wirtschaftsexperten, Politiker, Journalisten und Historiker sich nach dem Zusammenbruch des osteuropäischen Sozialismus der Illusion hingaben, damit seien Marktwirtschaft, Kapitalismus, Freiheit und Demokratie auf dem Weg zum globalen Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Wurde der Aufstieg Chinas, seine Stellung in Südostasien, Ambitionen im pazifischen Raum und in Afrika unterschätzt, weil oder obwohl die Einparteien-Diktatur der KPCh während und nach dem Massaker des 4. Juni 1989 auf dem Tian’anmen ihren Machtanspruch demonstrierte?
Vielleicht konnten sich die meisten nicht vorstellen, dass „sozialistische Marktwirtschaft“ in globalen Beziehungen mit fast allen Staaten funktioniert, wenn eine Ein-Parteien-Diktatur auf starre Pläne für Unternehmen, Binnen- und Finanzwirtschaft verzichtet, die Privatwirtschaft fördert, das Land weitgehend dezentral verwaltet und dem Gros des Volkes ein Leben im Wohlstand erlaubt. Die chinesische Führung zeigt sich zugleich sehr genau über weltweit agierende Kräfte und ihre Strategien informiert, bietet sich als innovationsstarker und verlässlicher Partner an, unterdrückt aber jegliche politische Einflussnahme ebenso rigide wie Opposition im eigenen Lande. Das „Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung“ macht einiges verständlich: Im „real exisiterenden Sozialismus“ des von der UdSSR dominierten RGW waren alle Versuche wirtschaftlicher Reformen an der Angst der ideologietreuen Nomenklatura vorm politischen Kontrollverlust gescheitert – und Gorbatschows „Perestroika“ führte ihn schließlich herbei.
Die Autoren des Jahrbuchs beleuchten nun interessante Querverbindungen und Unterschiede zwischen frühen – fast vergessenen – Reformversuchen in Osteuropa und dem chinesischen Pfad zur ökonomischen Weltmacht. Der Leser erfährt, wie sorgfältig chinesische Experten die Entwicklungen in Titos Jugoslawien, in Polen, Ungarn und der CSSR analysierten und mit Experten von dort kooperierten, ohne zu kopieren. Denn was dort in den 60er Jahren einige Geburtsfehler sozialistischen Wirtschaftens ausgleichen sollte, erwies sich als wenig erfolgreich – oder wurde aus politischen Gründen abgewürgt wie der Prager Frühling 1968. So war es auch Bemühungen von Deng Xiaoping und Liu Shaoqi Anfang der 60er Jahre ergangen, als sie nach Maos größenwahnsinnigem „Großen Sprung“, der -zig Millionen Hungertote forderte, insbesondere die Landwirtschaft reformieren wollten. Der „Große Vorsitzende“, um seine Macht besorgt, entfesselte die Kulturrevolution, das Land versank im Chaos.
Gleichwohl gab es schon in den 70er Jahren Wirtschaftsbeziehungen in den Westen – noch bevor Henry Kissinger mit seiner „Pendeldiplomatie“ und Zhou Enlai die Beziehungen der USA zu China neu ausrichteten. Die KPCh bestand immer auf Selbständigkeit vor allem gegenüber der Führung in Moskau. Die Beiträge des „Jahrbuches“ über die „Scharnierjahre 1974/1975“, und Chinas Engagement in Tansania zeigen beispielhaft, dass sowohl Mao als auch Deng in ihre Wirtschaftspolitik westliche Firmen einbezogen. Das Bemühen, weltweit als Führungs-macht der „unabhängigen Staaten“ wahrgenommen zu werden, hinderte die Chinesen auch nicht, in Afrika auf Jahre der Solidarität knallhartes Geschäft folgen zu lassen.
Alle wissenschaftlichen Beiträge habe ich mit großem Interesse gelesen; sie sind nicht nur für Fachleute aufschlussreich. Dass die politischen Unterschiede zu Osteuropa nur am Rande erörtert werden, ist kein Mangel. Wer das Geschehen in unseren östlichen Nachbarländern oder auch auf Kuba verfolgt, versteht, weshalb in Polen, Ungarn oder den Baltischen Staaten Globalistische oder sozialistische Parteien weniger erfolgreich sind als hierzulande: Freiheit und Nationalstolz gingen für viele dort mit dem Ende des Ostblock-Internationalismus einher. Für viele Chinesen dagegen gehören die KPCh und der Aufstieg ihres Landes zur Weltmacht zusammen. Liu Xiaobo, der von Xi Jinping zum Sterben aus dem Kerker entlassene Friedensnobelpreisträger, hat den chinesischen Nationalismus und dessen Gefahren in seinem Buch „Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass“ charakterisiert. Xi Jinping muss heute nicht einmal „China first!“ verkünden, um auf einen großen Konsens der Bevölkerung rechnen zu können. Nur wenige wagen, um einige Fußbreit politischer Freiheit zu kämpfen. Umso notwendiger bleibt Kommunismusforschung.
Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2020 – Machterhalt durch Wirtschaftsreformen. Chinas Einfluss auf die sozialistische Welt, Metropol Verlag Berlin, 256 Seiten, 29,00 €
Tags: Bulgarien, China, DDR, Geschichte, Jugoslawien, Kommunismusforschung, Polen, Reformen, RGW, Sozialismus, Tansania, UdSSR, Ungarn, Wirtschaft
Kommentare deaktiviert für Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2020Freitag, 07.02.2020
Autor: Christiane Geldmacher
Matthias Glaubrecht: Das Ende der Evolution
Ein spannendes Buch: „Das Ende der Evolution“ von Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker Matthias Glaubrecht. Glaubrecht hat Zoologie und Paläontologie in Hamburg studiert, Forschungsaufenthalte in Sydney am Australian Museum absolviert und er war Kurator am Museum für Naturkunde in Berlin. Heute leitet er eine der größten zoologischen Sammlungen Deutschlands im Centrum für Naturkunde in Hamburg.
Glaubrecht beschreibt in seinem sehr umfangreichen Buch, wie der Klimawandel und das Artensterben nach so vielen Jahrzehnten der wissenschaftlichen Erkenntnisse endlich auf der Straße angekommen sind. Heute treibt die Wissenschaft die Menschen und die Politik vor sich her – dazu bedurfte es in Europa nur zweier außergewöhnlich heißer Sommer. Jetzt konstatieren alle die Bevölkerungsexplosion, die Ressourcenverknappung, die Umweltzerstörung und: das Artensterben.
24 Prozent aller Säugetiere sind bedroht: 41 Prozent der Amphibien, 29 Prozent der Reptilien, 23 Prozent der Fische. Die großen Säugetiere sind mittelfristig nur noch in Naturparks oder Zoos zu bewundern; die Vögel haben keine Lebensgrundlage mehr und mit ihnen die Insekten. Der Mensch ist die invasivste Art der Erde, der die Existenz aller anderen Arten gefährdet.
Glaubrecht fordert, der menschlichen Überpopulation die Schlüsselrolle beim Verlust der Artenvielfalt und der natürlichen Lebensräume zuzuweisen. Das heißt nichts anderes, als sich nicht exponentiell zu reproduzieren und die Geburtenrate den Ressourcen des Planenten Erde anzupassen. Ein Drittel der Erde soll unter Naturschutz gestellt werden, Wälder aufgeforstet werden, Monokulturen und Massentierhaltung abgeschafft werden, Städte nicht weiter ausufern, sondern im Gegenteil rückgebaut werden.
Fazit: Es wird alles noch sehr viel schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Und man weiß nicht recht, ob man „Das Ende der Evolution“ tröstlich oder untröstlich finden soll. Denn wenn man alle Erkenntnisse zusammengetragen sieht, kann man der Erde und der Natur nur wünschen, dass das „Anthropozän“ so bald wie möglich vorbei ist. Nun: Wir rasen ja mit Siebenmeilenstiefeln darauf zu.
„Homo sapiens – das ist für die Erde, wenn es schlimm kommt, wie eine Erkrankung; aber das geht vorbei, so oder so.“ (S. 905)
Jedenfalls ertappt man sich bei der Lektüre, dass man gern das Jahr 2100 erleben würde: nur um zu sehen, wie die Sache „damals“ tatsächlich ausgegangen ist.
Matthias Glaubrecht: Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten. C. Bertelsmann, 2019
Dienstag, 24.12.2019
Autor: Andreas Schröter
Lara Prescott: Alles, was wir sind
 In ihrem Debütroman widmet sich die US-amerikanische Autorin Lara Prescott, geboren 1981, einer literarischen Legende: dem Roman „Doktor Schiwago“ von Boris Pasternak (1956). Legende einerseits, weil das Buch in der damaligen Sowjetunion lange verboten war – und es andererseits die USA als Propagandamittel im Kalten Krieg einsetzte.
In ihrem Debütroman widmet sich die US-amerikanische Autorin Lara Prescott, geboren 1981, einer literarischen Legende: dem Roman „Doktor Schiwago“ von Boris Pasternak (1956). Legende einerseits, weil das Buch in der damaligen Sowjetunion lange verboten war – und es andererseits die USA als Propagandamittel im Kalten Krieg einsetzte.
Folgerichtig gibt auch Lara Prescott ihrem Roman zwei Erzählstränge: „Osten“ und „Westen“. In beiden stehen Frauen im Mittelpunkt. Im Osten ist es Olga Iwinskaja, die als Muse des späteren Literaturnobelpreisträgers gilt und der er angeblich die Figur der Lara in seinem weltberühmten Roman nachempfunden hat. Im Westen sind es zwei Geheimagentinnen, die maßgeblich daran beteiligt sind, das Buch in die Sowjetunion zu schmuggeln.
Die Ost-Kapitel sind stärker, weil sie dramatischer sind: Olga muss als Komplizin des – in den Augen der Sowjetmacht – staatsfeindlichen Autors zweimal in alptraumhafte Straflager. Deutlich wird in diesen Textpassagen auch, wie egoistisch Pasternak handelt, als er der Veröffentlichung seines Romans zunächst in Italien zustimmt, obwohl er wissen muss, dass er Olga damit weiter schadet. Zudem trennt er sich nie von seiner Frau Sinaida, um ganz mit Olga zusammenzuleben.
Die West-Passagen dagegen wirken weniger dicht. Kürzungen hätten hier gut getan. Es geht um eine lesbische Liebesgeschichte zwischen den beiden Agentinnen Sally und Irina und um vieles andere, was man eher als Klatsch und Tratsch von Leuten bezeichnen kann, die weit weniger Sorgen haben als Olga Iwinskaja und Boris Pasternak in Russland.
Ein interessantes Detail: Die Autorin erhielt ihren Vornamen, weil ihre Mutter so begeistert von der weiblichen Hauptfigur in „Doktor Schiwago“ war – daher auch das Interesse und die Faszination Lara Prescotts für diesen Klassiker der Literaturgeschichte.
——————————
Lara Prescott: Alles, was wir sind.
Rütten & Loening, November 2019.
475 Seiten, Gebundene Ausgabe, 20,00 Euro.
Donnerstag, 19.12.2019
Autor: Andreas Schröter
Edoardo Albinati: Ein Ehebruch
 Erri und Clementina verbringen ein gemeinsames Wochenende auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer. Sie sind verheiratet, aber nicht miteinander. Ihren Ehepartnern haben sie irgendwelche Lügengeschichten aufgetischt.
Erri und Clementina verbringen ein gemeinsames Wochenende auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer. Sie sind verheiratet, aber nicht miteinander. Ihren Ehepartnern haben sie irgendwelche Lügengeschichten aufgetischt.
Der 1956 geborene italienische Schriftsteller Edoardo Albinati hat dem Ehebruch einen schmalen Roman gewidmet, den Verena von Koskull übersetzt hat.
Die Lust der beiden Protagonisten aufeinander ist so groß, dass sie schon übereinander herfallen, als ihr Hotelzimmer noch nicht fertig ist – im Wasser, während sie sich an einem gemieteten Motorboot festklammern. Und so geht es dann die nächsten 128 Seiten mehr oder weniger weiter. Man hat Sex miteinander. Viel Sex.
Gleichzeitig sorgen sich die beiden Liebenden, die sich erst seit drei Wochen kennen. Wie wird es nach dem Wochenende weitergehen? Sollen sie ihre Ehepartner verlassen?
Diese Beschreibung klingt so, als könnte „Ein Ehebruch“ ein durchaus reizvolles Büchlein sein – erotisch, aber nicht zu banal. Dem ist leider nicht so. Der Sex, den die beiden permanent miteinander haben, bleibt spröde. Der Autor behauptet ihn zwar permanent, macht die Gefühle der beiden füreinander aber für den Leser nicht nachvollziehbar. Und die erwähnten ernsthaften Gedanken balancieren immer auf der Schwelle zum Pathos und zum Kitsch.
Auch bleiben die Figuren seltsam diffus und fremd. Der Leser lernt sie im ganzen Roman nicht richtig kennen. Über ihre Vergangenheit oder das Leben, das sie führen, wenn sie nicht für ein Wochenende auf einer Insel sind, erfährt man wenig.
Edoardo Albinati ist in Italien seit seinen 1300-Seiten-Wälzer „Die katholische Schule“ – die deutsche Übersetzung erschien 2018 – ein gefeierter Autor. In seiner Heimat erhielt er dafür den Premio Strega, die wichtigste literarische Auszeichnung des Landes.
—————
Edoardo Albinati: Ein Ehebruch.
Berlin Verlag, November 2019.
128 Seiten, Gebundene Ausgabe, 20,00 Euro.
Sonntag, 15.12.2019
Autor: Andreas Schröter
Ian McEwan: Die Kakerlake
 Bereits sechs Monate nach seinem vorigen Roman „Maschinen wie ich“ legt der renommierte britische Schriftsteller Ian McEwan schon sein nächstes, allerdings mit rund 130 Seiten recht kurzes Werk vor: „Die Kakerlake“.
Bereits sechs Monate nach seinem vorigen Roman „Maschinen wie ich“ legt der renommierte britische Schriftsteller Ian McEwan schon sein nächstes, allerdings mit rund 130 Seiten recht kurzes Werk vor: „Die Kakerlake“.
In einer umgekehrten kafkaesken Verwandlung sieht sich eine Kakerlake eines Morgens „nach unruhigem Schlaf“ in einen Menschen verwandelt, bei dem es sich – zufällig oder nicht – um den englischen Premierminister handelt.
Sams gewöhnt sich schnell an sein neues Dasein und setzt künftig all seine Kraft in die Durchsetzung von etwas, das er „Reversalismus“ nennt, den umgekehrten Geldfluss: Wer arbeitet, muss dafür bezahlen, wer einkaufen geht, bekommt Geld.
So satirisch-bissig kommentiert Ian McEwan das derzeitige Brexit-Chaos um den britischen Premierminister Boris Johnson.
Jim Sams, so heißt McEwans Premierminister, stellt zu seiner großen Freude fest, dass auch die meisten anderen Kabinettsmitglieder verwandelte Kakerlaken sind. Jetzt gilt es nur noch diejenigen auszumerzen, die nicht dazugehören. Die vielleicht witzigste Stelle im Buch ist, wenn Sams den amerikanischen Präsidenten anruft und ihn fragt, ob er früher ebenfalls sechs Beine gehabt hat. Wie der reagiert, soll hier nicht verraten werden.
Als Sams spürt, dass seine Mehrheit für den Reversalismus zu schwanken beginnt, sorgt er mit einem äußerst fiesen Trick für Klarheit …
„Die Kakerlake“ ist unterhaltsam und witzig – auch wenn Briten diesen Roman womöglich noch spaßiger finden als Kontinental-Europäer.
Während die Sache mit dem verwandelten Ungeziefer recht schnell in den Hintergrund tritt, bietet die komplett widersinnige Theorie des Reversalismus später einiges an Humor.
Es ist jedoch ein Vorteil, dass dieser Roman so kurz ist. Nach 130 Seiten ist es dann auch genug mit den Kakerlaken in Regierungsverantwortung.
———————–
Ian McEwan: Die Kakerlake.
Diogenes, November 2019.
112 Seiten, Gebundene Ausgabe, 19,00 Euro.
Donnerstag, 05.12.2019
Autor: Immo Sennewald
Klaus-Jürgen Bremm: 70/71 – Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen
 Der Krieg, dessen Höhepunkt die Gefangennahme und Kapitulation des französischen Kaisers Napoleon III. war, und als dessen wichtigstes Resultat in Schulbüchern gemeinhin die Proklamation des Deutschen Kaiserreiches im Spiegelsaal des Versailler Schlosses erscheint, ist in Archiven und Sammlungen sehr gut dokumentiert, darüber hinaus auch in den damaligen Zeitungen. Die Ära der Massenmedien hat begonnen: Illustrationen – meist Stiche nach Photographien – steigern Reichweiten, Attraktivität und Wirkung der Presse enorm, sie werden das Entstehen und den Verlauf kommender Kriege mitbestimmen. Wie groß die Bedeutung der Propaganda seinerzeit schon war, lässt ein Bericht der “Gartenlaube” aus den Anfangswochen des Krieges erkennen.
Der Krieg, dessen Höhepunkt die Gefangennahme und Kapitulation des französischen Kaisers Napoleon III. war, und als dessen wichtigstes Resultat in Schulbüchern gemeinhin die Proklamation des Deutschen Kaiserreiches im Spiegelsaal des Versailler Schlosses erscheint, ist in Archiven und Sammlungen sehr gut dokumentiert, darüber hinaus auch in den damaligen Zeitungen. Die Ära der Massenmedien hat begonnen: Illustrationen – meist Stiche nach Photographien – steigern Reichweiten, Attraktivität und Wirkung der Presse enorm, sie werden das Entstehen und den Verlauf kommender Kriege mitbestimmen. Wie groß die Bedeutung der Propaganda seinerzeit schon war, lässt ein Bericht der “Gartenlaube” aus den Anfangswochen des Krieges erkennen.
Der Militärhistoriker Klaus-Jürgen Bremm hat eine Gesamtschau politischer, militärischer, technischer Entwicklungen und des Geschehens verfasst; er konnte auf eine kaum fassbare Fülle an Material bis hin zu Berichten von Augenzeugen zugreifen. Er hat klug ausgewählt, lässt beide Seiten und internationale Beobachter sprechen und erzählt so spannend, dass mir von der Einleitung an die Lust am Lesen niemals ausging. Schon die politische Vorgeschichte animierte mich darüber hinaus, im Internet nach weiteren Details zu suchen, etwa zum Chassepot-Gewehr, das dem deutschen Zündnadelgewehr überlegen war, wenn es auch die Niederlagen französischer Armeen letztlich nicht verhindern konnte. Der Autor regt immer wieder an, zukünftige Entwicklungen mitzudenken: dass Logistik und Mobilität der Truppen, auf Eisenbahnen gegründet, den Ausgang von Schlachten entschieden, wie Informationsflüsse von funktionierenden Telegraphen abhingen, wie die Wehrpflicht die deutsche Heerführung begünstigte und auf beiden Seiten der Rückhalt in der Bevölkerung den Kriegsverlauf mitbestimmte.
Wer selbst einmal stundenlang ungeschützt im Schlamm bei Wind und Regen unter freiem Himmel ausharren oder im Schützengraben eine Frostnacht durchstehen musste, hat zumindest eine Ahnung von den Leiden der Soldaten – Verwundung, Gefangennahme, Hunger und Tod kann er sich kaum vorstellen. Offiziere fielen häufig als erste, weil sie den Truppen Vorbild sein wollten; „skin in the game“ würde das heute heißen. Noch gab es Kämpfe Mann gegen Mann, aber deutsche Artillerie, französische Mitrailleusen als Vorläufer der Maschinengewehre wiesen auf die Vernichtungskraft künftiger Militärtechnik, Bombardements von Städten auf entgrenzte Gewalt in länger anhaltenden Konflikten hin.
Selbst in den wenigen Monaten dieses Krieges nahmen die Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung zu. Hunger und Seuchen, Plündern und Vergewaltigen, das Eingreifen von Guerilla, den sogenannten Franctireurs, gefolgt vom Niederbrennen ganzer Ortschaften zur Vergeltung erscheinen in Bremms Buch wie Wetterleuchten späterer Vernichtungsfeldzüge, Genozide, lassen den „Totalen Krieg“ vorausahnen.
Der Autor betrachtet gleichwohl den Triumph der Sieger, die Annexion von Elsass-Lothringen, den Friedensschluss Bismarcks nicht als simple Ursache kommender Weltkriege. Das deutsche Kaiserreich stabilisierte zunächst die europäische Ordnung. Die Schlächtereien des 20. Jahrhunderts bedurften vieler Faktoren – etwa des Emporkommens imperialer Impulse über den bloß nationalen Rahmen hinaus – um unvorstellbare Leichenberge und Zerstörungen zu hinterlassen. Mag auch manchen Sozialisten die Pariser Kommune von 1871 heute noch Probestück einer besseren Gesellschaft sein: Sie trägt den Keim jener Massaker in sich, die totalitäre Systeme im Gefolge kommender Revolutionen prägten.
Mehr als Fakten, Ereignisse und Personen eröffnen sich dem Leser, und über heutige ungelöste – womöglich unlösbare – Konflikte einer auf Frieden zielenden Politik nachzudenken, legt der Autor ihm nahe. Reichlich Stoff für qualifizierten Geschichtsunterricht.
Klaus-Jürgen Bremm „70/71 – Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen“ 336 S. mit 27 s/w Abb. und Karten, 2019 wbg Theiss, Darmstadt.
Tags: Bismarck, Deutsches Kaiserreich, Frankreich, Krieg 1870/71, Napoleon III., Pariser Kommune, Preußen, Propaganda, Sedan, Wilhelm I.
Kommentare deaktiviert für Klaus-Jürgen Bremm: 70/71 – Preußens Triumph über Frankreich und die FolgenFreitag, 29.11.2019
Autor: Andreas Schröter
James Wood: Upstate
 Ein älterer Immobilienmakler namens Alan reist mit seiner Tochter Helen von England ins winterlich kalte New York, um seine andere Tochter Vanessa zu besuchen und um ihr zu helfen. Sie hat sich bei einem Treppensturz den Arm gebrochen, und es erscheint nicht ganz sicher, ob sie diesen Treppensturz nicht sogar selbst in selbstmörderischer Absicht herbeigeführt hat. Schon früher hatte sie mit Depressionen zu kämpfen.
Ein älterer Immobilienmakler namens Alan reist mit seiner Tochter Helen von England ins winterlich kalte New York, um seine andere Tochter Vanessa zu besuchen und um ihr zu helfen. Sie hat sich bei einem Treppensturz den Arm gebrochen, und es erscheint nicht ganz sicher, ob sie diesen Treppensturz nicht sogar selbst in selbstmörderischer Absicht herbeigeführt hat. Schon früher hatte sie mit Depressionen zu kämpfen.
Soweit die Ausgangssituation in James Woods Roman „Upstate“, der von Tanja Handels übersetzt worden ist. Der Titel bezieht sich auf den Ort der Handlung: Upstate New York – im Gegensatz zu New York City.
Der Roman des 1965 in England geborenen Autors, der als Professor für angewandte Literaturkritik an der Harvard University arbeitet, ist relativ handlungsarm, dafür aber reich an Dialogen zwischen vier Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Da ist die quirlige Helen, die im Musikbusiness arbeitet, recht dominant auftritt, oft mit ihrem Handy beschäftigt ist und ihren Vater zum Einstieg in eine „todsichere“ Zukunftsidee zu überreden versucht – auch finanziell.
Dann die ruhige Philosophie-Dozentin Vanessa mit Hang zum Schwermut, Alan, der zu helfen versucht, und Vanessas Freund Josh, der Schwierigkeiten hat, an der Seite einer depressiven Partnerin zu leben.
„Upstate“ – und das legt bereits das Thema „Depression“ nahe – ist kein heiteres Buch. Die als trist beschriebenen Städtchen im Bundesstaat New York und die Umgebung, die im Schneematsch versinkt, verstärken diesen Eindruck.
Es ist ein Buch, das sich den Konflikten innerhalb von Familien und zwischen den Generationen widmet. Oft sind es Nuancen, die eine Stimmung in einem Gespräch zum Kippen bringen können. Auch philosophische Überlegungen kommen vor. Und es ist ein Buch, das letztlich die Stärke des familiären Zusammenhalts beschwört, wie besonders am Ende deutlich wird.
—————
James Wood: Upstate
Rowohlt, November 2019
304 Seiten, gebundene Ausgabe, 22 Euro
Mittwoch, 27.11.2019
Autor: Andreas Schröter
Dorota Masłowska: Andere Leute
 Wie der wahnwitzige und rasante 160 Seiten lange Text eines gigantischen Rap-Songs wirkt Dorota Masłowskas Roman „Andere Leute“. Das Ganze hat Rhythmus und Drive, und man kommt aus dem Staunen nicht heraus über soviel Sprachvirtuosität.
Wie der wahnwitzige und rasante 160 Seiten lange Text eines gigantischen Rap-Songs wirkt Dorota Masłowskas Roman „Andere Leute“. Das Ganze hat Rhythmus und Drive, und man kommt aus dem Staunen nicht heraus über soviel Sprachvirtuosität.
Der Warschauer Plattenbau-Loser und Kleinkriminelle Kamil sieht sich als Künstler und will unbedingt eine Rap-CD aufnehmen. Vorerst jedoch muss er sich mit seiner trinkfreudigen Mutter und der streitsüchtigen Schwester herumschlagen, mit denen er notgedrungen zusammenlebt.
Unerwartetes Geld: Als sich ihm bei einem Gelegenheitsjob als Klempner-Gehilfe die vom Ehemann gehörnte und gelangweilte Iwona an den Hals wirft, scheint zumindest Kamils momentaner Geld-Engpass behoben zu sein, denn Iwona hat nichts dagegen, Kamil für seine Liebes-Dienste zu entlohnen.
Der Star in diesem Roman ist eindeutig die Sprache. Es ist faszinierend, welche frechen Sprachkaskaden Autorin Dorota Masłowska und mit ihr natürlich Übersetzer Olaf Kühl (selbst ein erfolgreicher Romanautor) zu Papier bringen. Das macht schlicht Spaß, erfordert aber ein gewisses Maß an Konzentration beim Lesen. 160 Seiten für eine solche Art von Roman sind genau die richtige Länge. Wäre er länger, würde dieser Stil ermüden.
Ein Reigen: Der ganze Text lässt sich als eine Art Reigen verstehen (Arthur Schnitzler lässt grüßen), kommen doch die handelnden Personen immer mal wieder in unterschiedlichen Konstellationen miteinander in Kontakt – auch der gehörnte Ehemann Iwonas mit dem durch den Roman stolpernden Kamil.
Dorota Masłowska, geboren 1983 in Polen, erhielt 2005 für ihren Debütroman „Schneeweiß und Russenrot“ den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihre weiteren Romane hießen „Die Reiherkönigin“ und „Liebling, ich habe die Katzen getötet“. Die Autorin wurde mit den wichtigsten polnischen Literaturpreisen ausgezeichnet.
———————–
Dorota Masłowska: Andere Leute.
Rowohlt, November 2019.
160 Seiten, Gebundene Ausgabe, 18,00 Euro.
Samstag, 23.11.2019
Autor: rwmoos
Karen Dionne: Die Moortochter. Hörbuch, gelesen von Julia Nachtmann
Wege aus dem Paradies
Die Moortochter
Ein gutes Hörbuch ist ein bisschen wie beamen: Zusammen mit einer passablen Flasche fränkischen Bieres verkürzt es die langen Stunden der Autofahrten gewaltig – und ehe man sich versieht, ist man schon am nächtlichen Ziel angelangt.
Hakan Nesser zum Beispiel. Einige Sachen von ihm haben mir mehrere tausend Kilometer ins Nichts aufgelöst. Hakan beam me up!
Andererseits hat er auch Sachen geschrieben wie das jüngst gehörte „Himmel über London“. Um da die Stunden nicht zu spüren, bräuchte man deutlich mehr Alkohol. Schwierig, wenn man aufpassen muss, dass man sich immer knapp unterhalb jener 0,3 Promillegrenze bewegt, die einen im Unfall-Fall den Versicherungsschutz kosten würde.
Da schreibt der Mann Seiten über Seiten. Auch der Vorleser müht sich redlich – und dann merkt man, dass der ganze Roman viel schneller in zwei alternierenden Kurzgeschichten über einen Barbier zu erledigen gewesen wäre, die Herr Nesser in das letzte Viertel der sich ewiglang dahinziehenden Altherrenerzählung als Story in der Story durchaus gewinnbringend zu erzählen weiß.
Die Frau, die mich im realen Leben einerseits liebt, mir andererseits gern auf den Solarplexus haut, steckt mir vor der nächsten Fahrt zum Trost zwei neue Hörbücher zu: Die „Känguru-Apokryphen“ von Marc-Uwe Kling und „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde.
Herrn Klings Werke zu kommentieren, erübrigt sich: Was man sich einverleibt, kann man nicht mehr rezensieren. Da fehlt der Abstand. Meine achtjährige Tochter, die mich gerade begleitet (weswegen ich auf Alkohol verzichte), bringt es so auf den Punkt: „Ich will das Känguru sein!“
Doch dann steht die nächste Fahrt mit Maja Lunde statt meiner Tochter und Herrn Kling an. Normalerweise halte ich ja aus Prinzip auch Sachen durch, die mir nicht sonderlich gefallen. Bei der Lundalen Bienengeschichte aber muss ich passen. Das Ganze ist wohl nur was für BuchhändlerInnen mit großem Binnen-I und Wohlstandsgrüne, die keine Ahnung von Natur und Technik haben, sich aber – wie weiland Helmut Markwort formulierte – „meinungsstark und faktenarm“ offenbar recht erfolgreich durchs Leben schlawinern.
Genervt lasse ich die Scheibe aus dem CD-Schacht direkt auf die Fußmatten fallen, steuere meinen Prius, der ja ab und an auch ein wenig Benzin zum Leben braucht, an die Autobahntanke und suche dort nach dem nächstbesten Hörbuch. Die angebotene Literatur ist nicht gerade anspruchsvoll. Aber abgesehen von den ganzen Frauen-Büchern im Brigitte-Charme, lässt sie sich sicher gut weghören. Ich greife zu:
Ein Krimi, genauer: ein Psycho-Thriller. Laut Klappentext. Egal. Hauptsache das Beamen klappt.
Und dann nimmt mich eine Geschichte gefangen, die mit ihrer Vielschichtigkeit so nicht erwartbar gewesen war: Die Geschichte von der Tochter des Moorkönigs (The Marsh King‘s Daughter).
Ein Ojibwe (wer’s nicht weiß: das ist ein Angehöriger eines Stammes indianischer Ureinwohner aus dem Gebiet der Großen Seen) beschließt, mit seiner künftigen Familie das Leben wie seine Vorfahren fernab der Zivilisation zu verbringen. Ein leerstehendes Haus findet sich dort. Eine Frau raubt er sich von einem feindlichen Stamm, nämlich von den Weißen. Die beiden bekommen ein Kind, das nun isoliert vom Rest der Welt aufwächst.
Während sich der Mann seinen Lebenstraum verwirklicht, ist es ihm offenbar egal, dass er damit die Träume der Frau zerstört hat. Er allein weiß, was richtig und falsch ist und scheut auch nicht davor zurück, diese Sicht mit roher Gewalt durchzusetzen.
Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Aber dies ist nicht die Geschichte des Mannes. Es ist erst recht nicht die Geschichte der Frau. Es ist die Geschichte der Tochter.
Einerseits wächst sie völlig naturverbunden auf. Andererseits kennt sie aus den wenigen Erzählungen ihrer Mutter, den noch rareren Bestätigungen ihres Vaters und ein paar Dutzend im Haus aufgefundener, längst veralteter National-Geographic-Heften durchaus die Welt „da draußen“. Jene Welt, die für uns die „normale“ Welt ist.
Einerseits ist sie fasziniert von ihrem Vater, dem sie in inneren und äußeren Belangen wie ein kleiner Schatten folgt.
Andererseits beginnt sie langsam zu verstehen, dass ihrer Mutter, die sie wegen deren Schwäche eigentlich gar nicht für voll nimmt, bitteres Unrecht geschehen ist.
Unterdessen reift die inzwischen Elfjährige zu einer jungen Frau heran, die aufgrund der harten Schule ihres Vaters auch allein in der Wildnis zurechtkommt, Fährten lesen und Nahrung erbeuten kann und vor allem in der Lage ist, schnelle Entscheidungen zu fällen.
Als Tochter ihres Vaters wird sie ein vollwertiger First-Nations-Krieger. In unserem Kulturkreis würde man sagen: Eine junge Indianerin. Oder besser: Ein junger Indianer.
Als Tochter ihrer Mutter aber lernt sie abendländische Werte-Systeme, vermittelt über Märchen und Seufzer.
Sie wird sich dieses Zwiespalts immer bewusster, bis sie es irgendwann schafft, sich zumindest so weit von ihrem übermächtigen Vater zu lösen, dass sie eine Flucht schafft, auf der sie ihre halbtote Mutter mitnimmt.
Doch statt der erhofften Befreiung, gerät sie nun in die Fänge der Zivilisation, die mit einem Menschen wie ihr auch nicht recht etwas anzufangen weiß. Ein Deputy Sheriff, der sie bei ihren bald folgenden Ausreiß-Versuchen immer wieder einfangen muss, wird ihr da noch am Ehesten zum Vertrauten. Indes entpuppen sich die Großeltern als typische Amis, die lediglich die Geschichte von Tochter und Enkelin einigermaßen gut zu vermarkten wissen.
Die Mutter schafft den Schritt in ein neues Leben unter diesen Bedingungen auch nicht mehr wirklich und stirbt früh. Der Vater wird nach einigen Jahren, die er in der Illegalität verbringt, verhaftet und wandert lebenslänglich ins Gefängnis.
Unter diesen Bedingungen verstärkt sich wieder die innere Bindung der jungen Frau an den abwesenden Vater. Er, der sie doch eigentlich immer nur manipuliert hatte, ist der einzige Mensch, dem sie zumindest das Potential zubilligt, sie verstehen zu können.
So bleibt diese Bindungsfrage auch noch ungelöst, als sie sich bei Erreichung der Selbstständigkeit ein eigenes Leben aufbaut. Ihr Mann, ein Naturfotograf, und ihre beiden kleinen Töchter wissen nichts von ihrer Vergangenheit. Diese immanente Lüge wird sich später als Gift entpuppen, spätestens als ihr Vater aus dem Gefängnis ausbricht, seine Feinde tötet und zu einer Gefahr für die kleine Familie wird.
Die Tochter des Moorkönigs beschließt, sich dieser Gefahr zu stellen und jagt ihren Vater, indes dieser sie jagt. Doch aufgrund der alten Verwicklungen ist es nicht nur eine äußerliche Jagd – die eigentlichen Kämpfe finden in der Psyche statt …
…
Natürlich kann man ein solches Buch, das sich jeglicher Kategorie entzieht, als Psycho-Thriller bezeichnen. Unter dieser Rubrik verkauft sich derzeit Literatur offenbar recht gut. Andererseits weckt das auch Genre-Erwartungen, die das Werk nicht erfüllen will und kann.
Einige negative Rezensionen, die ich gelesen habe, sind schlichtweg das Ergebnis derart enttäuschter Erwartungshaltungen.
Da ich aber so gut wie keine Erwartungen hatte, ist es mir möglich, die Subtilität des Werks ein wenig neutraler zu würdigen.
Ja – es gibt ein paar technische und zeitliche Fehler. Die sind anderswo bereits zur Genüge benannt. Und ja – an einigen wenigen Stellen ist die Handlung nur schwer schlüssig. Da wirken die Übergänge doch ein wenig arg konstruiert.
Aber wenn man die Anlage des Romans begriffen hat – und ich unterstelle mir mal, dass ich das habe – dann kann man darüber hinweghören. Zumal an Julia Nachtmanns Vorlese-Kunst bei dieser Arbeit nichts, wirklich rein gar nichts zu bemängeln ist. Hier hat sich jemand richtig in die Geschichte hineingeschafft, bevor sie den Mund auch nur zur ersten Lese-Silbe auftat. Respekt!
Was aber an dem Werk selbst fasziniert, ist die kompromisslose Fixierung auf die Hauptperson. Indem alle Zeiten und Geschehnisse nur aus ihrer Ich-Perspektive erzählt werden, kann man diese schwierige und ungewöhnliche Entwicklung einer Doppel-Psyche miterleben. Und das, obwohl die Entwicklung zur wiedervereinigten selbständigen Persönlichkeit, die aus dem Schatten von anderen (und aus ihrem eigenen) heraustritt, über zwei Jahrzehnte umfasst und dabei in diskontinuierlichen Sprüngen mit jeder Menge Rückschlägen erfolgt.
Andere Rezensenten bemängeln auch das Fehlen von Dialogen und von ausgebauten Nebencharakteren, wie man es von den 0815-Thrillern kennt, die man sich sonst so reinzieht – aber genau das ist bei dieser stringenten Darstellungsweise von Haus aus eben gar nicht möglich.
Ich hingegen habe festgestellt, dass es Frau Dionne geschafft hat, mir drei bis vier Geschichten gleichzeitig zu entwickeln: Die Geschichte der Tochter, die sie tatsächlich erzählt. Das ist soweit klar. Aber parallel dazu entstanden in meinem Kopf sowohl die Geschichte des Vaters als auch die der Mutter. Ein Stück sogar die Geschichte des Ehemanns, der es schafft, der schwierigen und in Lügen verfangenen Person der Erzählerin zu einer weiteren Entwicklung zu verhelfen, indem er ihr Ausweg und Heimat zugleich bietet. Und zwar – das sei hervorgehoben – ohne sich dabei selbst zu verleugnen.
Ich möchte fast sagen: Indem die Protagonistin die Geschichten dieser drei wichtigen Personen eben nicht selbstständig ausführt, hatten diese drei so unterschiedlichen Menschen die Chance, ihre Version auch selbst darzulegen, wenngleich sie nur in meinem Hirn zu Wort kamen.
Ich wage zu vermuten, dass die Autorin genau dies beabsichtigt hat. Sie erzählt Dinge, die kulturell und politisch zu heikel anmuten, indem sie sie entstehen lässt, ohne sie selbst formuliert zu haben. Denn sie geht ja mit der Anlage der Story ein arg vermintes Feld an:
Es wird nämlich in dem Werk ziemlich deutlich, dass die Figur des „Edlen Wilden“, die seit Rousseau über Karl May, Lieselotte Welskopf-Henrich und manchem faulen Zweig der Eine-Welt-Bewegung gern durch unsere Köpfe geistert, auch auf der Soll-Seite gewaltige Posten aufweist:
Mikro-Diktaturen, Entrechtung von Frauen und Kindern, jede Menge Gewalt, Herabsetzung von Hemmschwellen zur Tötung durch angelerntes Jagdverhalten, Unfähigkeit zur frei bestimmbaren Liebe – um nur einige zu nennen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das in den USA, in denen Quotendiskussionen auch in Bezug auf die First Nations, die, selbst steuerbefreit, inzwischen auf Kosten der Rest-Allgemeinheit respektablen Wohlstand aufgebaut haben, einige Irritationen hervorruft.
Gleiches gilt für die altreligiösen und neogrünen Zurück-Zur-Natur-Diskussionen.
Das Paradies war alles andere als paradiesisch. Erst indem er es verließ, brachte es der Mensch zu seinem Namen.
Leider vermisse ich bislang zumindest in der deutschsprachigen Rezeption des Werks jedwede Aufnahme dieser gewaltigen Denk- und Arbeitsleistung der Autorin.
Statt dessen wird bemäkelt, dass der Thriller nicht psycho genug und die Psychen nicht gethrillt genug seien. Nun ja. Das mag sogar richtig sein. Aber das betrifft im Wesentlichen wieder nur die Frage der Erwartungshaltung, die oben bereits gestreift wurde.
Vielleicht seien aber auch mir noch zwei kleine Mäkeleien gestattet:
Zunächst haut der deutsche Titel zielsicher daneben:
Aus „Die Tochter des Moorkönigs“ wurde „Die Moortochter“
Es geht aber in dem Werk eben nicht um ein Naturkind, eine Art Mowgli, auch wenn das vielleicht in den Augen des Verlags gerade en Vogue wäre.
Es geht um die Loslösung von einer übermächtigen schamanischen, ja, fast göttlichen Gestalt.
Des Weiteren mag das gleichnamige Hans-Christian Andersen Märchen, das als Leitfaden den einzelnen Kapiteln zwischengeschaltet ist, schon von Haus aus nicht zu den ganz großen literarischen Leistungen jenes namhaften Autors gehören. In der Kurzfassung, die Karen Dionne wiedergibt (oder auch vielleicht nur in der Kürzung der Hörspielfassung), wird das Märchen aber einiger wichtiger Aspekte beraubt.
Andererseits: Wenn die Protagonistin dem Märchen-Muster weiter gefolgt wäre – hätte sie dann ihren Über-Vater nicht nur gegen ein neues Über-Ich getauscht? Eventuell galt ja auch hier: Erst indem die Heldin die gezeichneten Schatten-Pfade verließ, wurde sie erwachsen.
Doch vielleicht sollte man da auch nicht zuviel in „Die Moortochter“ hinein-interpretieren.
Tüchersfeld, den 22.11.2019
Reinhard W. Moosdorf
Dienstag, 19.11.2019
Autor: Andreas Schröter
Stewart O’Nan: Henry persönlich
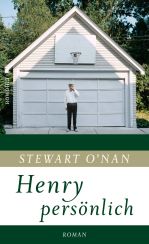 „Henry persönlich“ von Stewart O‘Nan ist quasi die Fortsetzung des 2011 erschienenen Romans „Emily, allein“ des 1961 geborenen US-amerikanischen Schriftstellers. Damals ging es um eine ältere Dame, die allein lebt, seit ihr Mann Henry vor sieben Jahren gestorben ist.
„Henry persönlich“ von Stewart O‘Nan ist quasi die Fortsetzung des 2011 erschienenen Romans „Emily, allein“ des 1961 geborenen US-amerikanischen Schriftstellers. Damals ging es um eine ältere Dame, die allein lebt, seit ihr Mann Henry vor sieben Jahren gestorben ist.
Der neue Roman widmet sich nun ganz eben jenem Henry. Das Paar, das in seinen 70ern ist, lebt ein beschauliches Leben in Pittsburgh. Henry, der etwas unter dem Pantoffel seiner Frau steht, geht mit dem Hund Rufus raus, fährt zum Baumarkt, repariert alles Mögliche am Haus und sieht sich abends Sport-Reportagen im Fernsehen an. Ab und zu kommt die Verwandtschaft zu Besuch, die nicht immer ganz unkompliziert ist. Und im Sommer geht’s ins Ferienhaus nach Chautauqua. Das ist aber auch schon das Aufregendste im Leben des älteren Paares.
Wie schon in „Emily, allein“ bewährt sich Stewart O‘Nan in der hohen Kunst, einen Roman zu schreiben, in dem eigentlich gar nichts passiert, der aber trotzdem auf keiner seiner vielen Seiten auch nur einen Hauch langweilig ist.
Das liegt vermutlich an dem hohen Identifikations-Potenzial, das der gemütliche, etwas verschrobene, aber insgesamt rundum sympathische Henry verströmt. Er gerät leicht in Panik, weil er nicht weiß, was er mit den Verwandten reden soll, isst gerne Kuchen und hat Angst vor Staus und im Winter glatten Straßen. Welcher Leser würde nicht jemanden kennen, der haargenau so ist, wenn er nicht gerade selbst solche Charaktereigenschaften hat?
Ganz nebenbei lernt der deutsche Leser auch etwas darüber, wie der Alltag für ein mittelständisches älteres Paar in den USA abläuft – mit Sportarten wie Baseball, Thanksgiving und einem fast aus dem Ruder laufenden Halloween-Abend.
Wer nicht auf Verfolgungsjagden, Morde und Serientäter steht, sich dafür aber an dem ganz normalen Alltag erfreuen kann, dem sei hiermit „Henry persönlich“ wärmstens empfohlen.
—————–
Stewart O’Nan: Henry persönlich.
Rowohlt, Oktober 2019.
480 Seiten, Gebundene Ausgabe, 24,00 Euro.
Freitag, 15.11.2019
Autor: oliverg
Das kleine Wiener Orakel (Video-Review und Live-Test)
Sonntag, 10.11.2019
Autor: Andreas Schröter
Daniel Kehlmann: Vier Stücke
 Daniel Kehlmann, der besonders mit seinem 2005 erschienenen Werk „Die Vermessung der Welt“ für Furore gesorgt hat, schreibt nicht nur erfolgreich Romane, sondern auch Theaterstücke. Vier davon sind nun in Buchform erschienen und heißen schlicht „Vier Stücke“.
Daniel Kehlmann, der besonders mit seinem 2005 erschienenen Werk „Die Vermessung der Welt“ für Furore gesorgt hat, schreibt nicht nur erfolgreich Romane, sondern auch Theaterstücke. Vier davon sind nun in Buchform erschienen und heißen schlicht „Vier Stücke“.
Ein Theaterstück lesend zu konsumieren und nicht als Bühnenfassung, ist per se nicht ganz einfach, weil vieles eben fehlt, was ein Theaterstück ausmacht: die Einfälle des Regisseurs, die schauspielerischen Leistungen mit Gestik, Dramatik, Emotionen und so weiter.
Insofern ist diese Lektüre vielleicht als etwas mühsam zu bezeichnen, obwohl es andererseits falsch wäre, „Geister in Princeton“, „Der Mentor“, „Heilig Abend“ und „Die Reise der Verlorenen“ misslungen zu nennen. Vielleicht lässt sich sagen, dass sie manchmal etwas verschwurbelt sind – zum Beispiel wenn der Protagonist in „Geister in Princeton“ mit seinem jüngeren Ich spricht oder die Akteure sich in „Die Reise der Verlorenen“ aus ihren Rollen lösen und direkt ans Publikum wenden. All das kann mit einem guten Regisseur gelingen, aber gelesen wirkt es gelegentlich etwas überdreht.
Die Stücke im Einzelnen: „Geister in Princeton“ dreht sich um das Leben des Kurt Gödel, den größten Logiker des 20. Jahrhunderts, der an Geister glaubte und im amerikanischen Exil, umzingelt von Ängsten, an Hunger starb. Das Springen durch die Zeiten und die Gespräche mit den Geistern wirken auf Dauer etwas überzogen. Auch Einstein kommt vor und wird als verschroben dargestellt.
In der Komödie „Der Mentor“ treffen ein berühmter alter und ein ehrgeiziger junger Schriftsteller aufeinander. Der Alte soll ein Stück des Jüngeren beurteilen. Die beiden finden nicht zueinander, wobei man schwer entscheiden kann, auf wessen Seite man eigentlich steht. Amüsant.
Im Echtzeit-Krimi „Heilig Abend“ verhört ein Polizist am Weihnachtstag eine Frau, weil er sie verdächtigt, um Mitternacht einen Anschlag verüben zu wollen – sie streitet alles ab, doch die Zeit läuft. Das ist durchaus spannend und erscheint in Zeiten mit terroristischen Anschlägen realistisch.
Und schließlich geht es in „Die Reise der Verlorenen“ um die Irrfahrt des Passagierschiffs St. Louis, auf der die Nazis 1939 knapp tausend Juden aus dem Land ließen. Historisch interessant, aber als Theaterstück in der Reihe dieser vier Stücke womöglich nicht das stärkste.
—————–
Daniel Kehlmann: Vier Stücke: Geister in Princeton / Der Mentor / Heilig Abend / Die Reise der Verlorenen.
Rowohlt, Oktober 2019.
288 Seiten, Gebundene Ausgabe, 24,00 Euro
Sonntag, 27.10.2019
Autor: Andreas Schröter
Eugen Ruge: Metropol
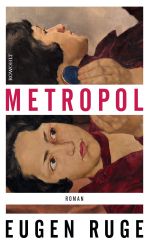 Eugen Ruge wurde 2011 für seinen Debütroman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Damals ging es um das Schicksal seiner Familie in der untergehenden DDR.
Eugen Ruge wurde 2011 für seinen Debütroman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Damals ging es um das Schicksal seiner Familie in der untergehenden DDR.
Nach einigen weniger erfolgreichen Romanen hat sich der 1954 geborene Autor nun erneut seiner Familie zugewandt. „Metropol“ springt gegenüber dem Erstling einige Jahre zurück und zeichnet das Leben Ruges Großmutter ab 1936 in der Sowjetunion nach.
Auf der Flucht vor den Nazis ist die Kommunistin Charlotte mit ihrem Mann Wilhelm in die UdSSR emigriert. Dort arbeiten beide in der „Komintern“, einer Organisation, in der Kommunisten aus dem Ausland tätig sind.
Doch schon bald rückt etwas in den Mittelpunkt ihres Daseins, das heute als die „Große Säuberung“ bekannt ist. Diktator Stalin ließ damals und auch später noch zum Teil völlig grundlos Menschen verhaften und zum Tode verurteilen, die seine Macht gefährden konnten. Es begann eine Zeit der Angst und der Denunziation.
Auch Charlotte und Wilhelm sind bedroht. Sie kannten jemanden der Verhafteten. Allein das reicht schon, sie ihres Jobs bei der Komintern zu entheben und sie im Hotel „Metropol“ – darauf bezieht sich der Titel – zu parken. Eine quälende Zeit der Ungewissheit beginnt.
Dem Autor gelingt es hervorragend, den Schrecken greifbar zu machen, dem politisch tätige Menschen in dieser Zeit in der Sowjetunion ausgesetzt gewesen sein müssen – einem Land, in dem man bei Minusgraden im Winter nach Lebensmitteln anstehen musste und es keine vernünftigen Schuhe gab.
Ruge stellt jedoch nicht allein Charlotte in den Vordergrund. Er lässt uns auch in die Köpfe eines Richters schauen, der Todesurteile am Fließband unterschreibt, und einer weiteren Komintern-Mitarbeiterin.
„Metropol“ ist ein würdiger Nachfolger des Erfolgsromans aus dem Jahre 2011.
——————-
Eugen Ruge: Metropol.
Rowohlt, Oktober 2019.
432 Seiten, Gebundene Ausgabe, 24,00 Euro.
Donnerstag, 17.10.2019
Autor: Immo Sennewald
Alexander Grau: Politischer Kitsch – eine deutsche Spezialität
 Den Begriff “Kitsch” gibt es wahrscheinlich erst seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, unsicher ist, ob er Lehnwort aus der Sprache der Roma, sicher, dass er als Lehnwort aus dem Deutschen ins Englische, Französische, Türkische, Griechische übernommen wurde. Der Artikel in der “Wikipedia” bietet Beispiele und Indizien, aber Kitsch präzise zu definieren gelang ebenso wenig, wie Dinge aus der Welt zu schaffen, die ihm zugerechnet werden. Alexander Grau, promovierter Philosoph und freier Publizist, widmet dem Phänomen – insbesondere seiner politischen und speziell der deutschen Spielart – einen Essay, den ich mit Vergnügen gelesen habe und weiterempfehle.
Den Begriff “Kitsch” gibt es wahrscheinlich erst seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, unsicher ist, ob er Lehnwort aus der Sprache der Roma, sicher, dass er als Lehnwort aus dem Deutschen ins Englische, Französische, Türkische, Griechische übernommen wurde. Der Artikel in der “Wikipedia” bietet Beispiele und Indizien, aber Kitsch präzise zu definieren gelang ebenso wenig, wie Dinge aus der Welt zu schaffen, die ihm zugerechnet werden. Alexander Grau, promovierter Philosoph und freier Publizist, widmet dem Phänomen – insbesondere seiner politischen und speziell der deutschen Spielart – einen Essay, den ich mit Vergnügen gelesen habe und weiterempfehle.
Ohne den kenntnisreichen und klug argumentierenden Text verkürzen zu können, drängten sich zwei Gedanken vor: Kitsch ist keineswegs harmlos, und es wird ihn geben, solange Menschen Dominanz- und Herdenimpulsen folgen, also auch noch dann, wenn Außerirdische auf die Überreste unserer Zivilisation stoßen. Vielleicht können sie klären, ob und inwieweit politischer Kitsch für deren Untergang ursächlich war.
Alexander Graus geistesgeschichtlichen Überlegungen zufolge gab es Kitsch schon in sehr frühen Kulturen, er hängt eng mit Religionen zusammen. Das ist nicht verwunderlich, denn in Auseinandersetzungen um die Macht gab und gibt es immer eine materielle und eine informelle Dimension; Kitsch hat einige Qualitäten, die ihn zum kommunikativen Kitt in Kollektiven prädestinieren. Wem es gelingt, einen Kultgegenstand, ein Ritual, eine Person, ein Ereignis im allgemeinen Bewusstsein zu überhöhen, als mehr erscheinen zu lassen, als es wirklich ist, also sich und anderen eine sinngebende, kollektive Bedeutsamkeit vorzutäuschen, wem das gelingt, der erlangt damit informelle Macht. Hat er Erfolg, kann er genügend Anhänger emotional an den (Kitsch-)Kult binden, wird er seine Deutungshoheit befestigen. Auch wenn die harte Realität ihn einmal widerlegt, muss das nicht Konsens und Konformität zerstören; es bedarf dazu katastrophalen Scheiterns, selbst das überlebt der Kitsch meist.
Das liegt zweifellos am Bedürfnis des Einzelnen, sich im Kollektiv geborgen zu fühlen: Die Familie, die Herde, die Organisation versprechen Schutz, Zusammenhalt, Teilhabe auch an materieller Macht – um den Preis konformen Verhaltens und Denkens. Alexander Grau sieht im Kitsch ein hochinfektiöses Pathogen, „insbesondere in Zeiten starker Veränderungen und Verunsicherung, wenn die Menschen anfällig sind für alles, was Geborgenheit verspricht, Nestwärme und Sicherheit.“
Von der säkularen Ausprägung des Politkitschs nach der Französischen Revolution, von seinen ebenso pompösen wie lächerlichen Wandlungen im 19. Jahrhundert, kommt der Autor zu den totalitären Systemen des Faschismus und Kommunismus; in beiden wird der Kitsch allgegenwärtig, sakrosankt – und wer kritische Fragen stellt, wird zum Feind, den es zu isolieren, zu bestrafen, zu vernichten gilt. Er zitiert Milan Kundera: „Unter diesem Gesichtspunkt kann man den sogenanten Gulag als Klärgrube betrachten, in die der totalitäre Kitsch seinen Abfall wirft.“
Sowohl der faschistische wie der antifaschistische und kommunistische Kitsch haben die Zusammenbrüche der jeweiligen Systeme trotz Millionen Menschenopfern gut überstanden, sie leben mit ihren Phrasen, Parolen, Symbolen, Ritualen in Erlösungsgeschichten für die jeweilige Gefolgschaft fort. Alexander Grau nennt ihn an der Realität gescheitert, nicht ohne im „absoluten Kitsch“, im „Traum von der totalen Versöhnung der Welt“, wiedergeboren zu werden – als der „Leitideologie spätbürgerlicher Gesellschaften“.
Das letzte Kapitel widmet er der „deutschen Spezialität“, und es ist amüsant, wie der auf Rationalität bedachte und der Gefühligkeit abholde Autor seinem Abscheu darüber Luft macht. Ich verstehe ihn gut. Insbesondere der „absolute Kitsch“ ist in seinen politischen, medialen, ästhetischen Auftritten schwer erträglich – aber noch gefährdet es nicht das Leben des Einzelnen, sich ihm mit Mut zu selbständigem Denken, scharfen Argumenten, beißendem Witz zu widersetzen. Nicht wenige wagen es. Das ist in China, in Russland, im Herrschaftsbereich von Gottesstaaten und sonstigen Diktaturen anders. Dort blüht der Kitsch, Gegenwehr kann tödlich sein. Er blüht auch in supranationalen Politbürokratien wie UN und EU. Ein verfasster politischer Wille, ihm den Garaus zu machen, ist schlechterdings nicht vorstellbar, zumal in den Subkulturen des Internets der Nachwuchs üppig gedeiht.
„Il faut cultiver notre jardin“, lässt Voltaire, der Aufklärer, am Schluss des Romans „Candide“ den gescheiterten Philosophen Pangloss sagen. Kitschfreie Bündnisse der Vernunft zwischen Naturwissenschaftlern, Künstlern, sogar manchen Politikern und Leuten, die „Was mit Medien“ machen, sind dabei immerhin noch möglich. In der „Blogosphäre“ zum Beispiel.
Alexander Grau „Politischer Kitsch“, Claudius Verlag, gebundene Ausgabe 128 Seiten, 14 €
Dienstag, 15.10.2019
Autor: Andreas Schröter
Darren McGarvey: Armutssafari
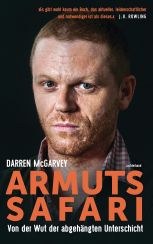 Darren McGarvey, geboren 1984, ist in einem Glasgower Problemviertel in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. Seine psychisch kranke sowie alkohol- und drogensüchtige Mutter hat ihn schwer vernachlässigt. Der Autor beschreibt unter anderem, wie sie ihn zum Zigaretten holen in einem heftigen Sturm nach draußen schickt und sich dann gemeinsam mit ihrem Lover auf dem Balkon darüber schieflacht, wie der kleine Darren fast wegfliegt und Todesangst aussteht.
Darren McGarvey, geboren 1984, ist in einem Glasgower Problemviertel in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. Seine psychisch kranke sowie alkohol- und drogensüchtige Mutter hat ihn schwer vernachlässigt. Der Autor beschreibt unter anderem, wie sie ihn zum Zigaretten holen in einem heftigen Sturm nach draußen schickt und sich dann gemeinsam mit ihrem Lover auf dem Balkon darüber schieflacht, wie der kleine Darren fast wegfliegt und Todesangst aussteht.
Wenn so jemand ein Buch über die Unterschicht schreibt, ist das per se glaubwürdiger, als wenn es ein Professor tut, der in gut behüteten Kreisen aufgewachsen ist.
„Armutssafari“ von Darren McGarvey, der auch als Rapper Loki bekannt ist, ist allerdings kein Roman. Es ist eine Mischung aus Autobiographie und soziologischen beziehungsweise sozialpsychologischen Überlegungen. Seine Kernbotschaft: Nicht nur die äußeren Umstände sind es, die die Menschen in die Armut und das Elend treiben, sondern auch ihre innere Einstellung, die durch jahrelanges Leben in den immergleichen Kreisen entstanden ist. McGarvey beschreibt anhand seiner eigenen Biographie, wie er sich selbst durch eine Änderung seiner Einstellungen zu einem besseren Leben verholfen hat.
Aber auch, was der äußere Einfluss angeht, laufe nicht alles optimal für die Unterschicht: Viele staatliche Hilfsprogramme würden ins Leere laufen, weil die Zielgruppe oft einfach keine Lust habe, an irgendwelchen Theaterprojekten teilzunehmen – manchmal wolle sie nur einen schlichten Raum zum Treffen.
„Armutssafari“ ist nicht immer einfach zu lesen. Die theoretischen Passagen sind stellenweise langatmig und redundant geschrieben und enthalten viele Fremdworte, die man auch dann nachschlagen muss, wenn man eine höhere Schulbildung hat.
Das Buch war in Großbritannien ein Bestseller und wurde mit dem Orwell Prize 2018 ausgezeichnet.
—————————
Darren McGarvey: Armutssafari.
Luchterhand, August 2019.
320 Seiten, Taschenbuch, 15,00 Euro.

Mit flattr kann man Bloggern mit einem Klick Geld zukommen lassen. Infos
Tagcloud
-
autor
Belletristik
Belletristik: Krimi
Belletristik: Phantastik
Berlin
Blog
Buchmesse
Buchpreis
Bücher
China
Comic
Das Wortreich
DDR
Demokratie
deutsch
England
Fantasy
Geschichte
harry potter
Humor
Interview
Klassiker
Kritik
Kurzgeschichten
Leben
Leipzig
Lesung
Literatur
Lyrik
medien
Philosophie
Politik
Religion
Rezension
Roman
Russland
Sachbuch
Schreiben
Science Fiction
Sprache
Stasi
USA
verlage
VideoBuchDuell
Wissenschaft
Empfehlungen
- Alban Nikolai Herbst
- 1 Audible Hörbuch kostenlos
- Bücher Preisvergleich
- carpe librum (Rezensionen)
- Autoren-Blogs, deutsch
Unsere Projekte
- Die Dschungel
- litblog-BW
- Die Geschichte vom Frosch
- Cyberabad: T-Shirts
- Gratis-Weblog in Autorennetzwerk buecherbrett.org
- Die Geschichte von Allesman
- Literaturwelt
- Digitale Tage
- Molochronik
- Tag um Tag
Letzte Kommentare
- Impressionen von der Buchmesse: […] Gassner, Chef-Blogger, kann auch lesen, […]
- rwmoos: Tipp angekommen und akzeptiert 🙂
- Manja: Interessante Rezension. Darf ich dir als kleinen Tipp was mitgeben? Verwende evtl. Zwischenüberschriften. Das lockert alles etwas auf. 🙂
- Christiane Geldmacher: Ja, das ist ein gutes Buch, auch wenn es sehr ambivalent ist; weil es keine Frage ist, dass es das Beste für alle anderen wäre, wenn wir Menschen wieder abhauen würden. Wir scheitern alle in Echtzeit am Turbokapitalismus und an der klimatischen Katastophe. Gerade die Industrieländern mit ihrem Energieverbrauch und Konsumrausch. So gesehen. Bin gespannt, wie es ausgeht, aber ich sehe es alles sehr schwarz. Die Megacitys sind nicht in den Griff zu bekommen, vermute ich. LG Christiane
- Mikka Gottstein: Hallo, das Buch hat schon in der Vorschau meine Neugierde geweckt. Ich kenne leider immer noch Menschen, die den Klimawandel leugnen – da kann ich nur ratlos den Kopf schütteln. Ich hatte den Klimawandel schon vor Greta Thunberg auf dem Schirm, aber sie bringt die Dinge auf den Punkt und die Leute dazu, darüber zu sprechen. Wie stehen wirklich am Anfang eines Massensterbens, warum braucht es da erst ein (zu Recht) wütendes Schulmädchen, damit die Menschen aufhorchen... Mein Mann und ich schauen zum Beispiel jedes Jahr die Papageitaucher-Webcams von Explore.org, und da ist es schon vorgekommen, dass fast alle Küken auf der Insel verhungert sind, weil die Fische, die für sie klein genug sind, aufgrund der höhren Wassertemperatur tiefer schwimmen und die Eltern daher nicht mehr genug davon fangen können. Ich fange jetzt besser gar nicht von den Zahlen an, in welchem Ausmaß die Papageitaucher in anderen Gegenden aussterben... Ich bin mir nicht sicher, ob es uns Menschen im Jahr 2100 noch geben wird; so langsam merken wir ja, dass es nicht nur die Tiere sind, die der Klimawandel betrifft. Das Zeitalter der Klimaflüchtlinge hat schon begonnen. LG, Mikka
Kategorien
- Allgemein (1.656)
- Altern (3)
- Ausstellungskatalog (1)
- Autobiographie (10)
- Ökologie (9)
- Belletristik (399)
- Belletristik: Klassisches (68)
- Belletristik: Krimi (81)
- Belletristik: Phantastik (75)
- Bericht (12)
- bibliomanie (10)
- Bildband (3)
- Biologie (4)
- Blogging for Catering (1)
- DDR (7)
- Demokratie (25)
- Dokumentation (4)
- Dukumentation (2)
- Energie (3)
- Erzählung (8)
- Geschichte (33)
- Kernkraft (2)
- Kinder und Jugend (67)
- Kultur (25)
- Liebesgeschichte (3)
- Liveblogging (67)
- Lyrik (21)
- Medien (31)
- Medizin (5)
- Philosophie (10)
- Politik (29)
- Politisches Buch (13)
- Psychologie (25)
- Sachbuch (185)
- Termin (113)
- Theater (5)
- Wissenschaft (30)
- Zukunft (34)
Links / Blog'n'Roll
- Literaturwelt unterstützen
- Ein Projekt von: carpe.com
- Bücher von Harold Pinter (Shop)
- Gutenberg-DE
- Gratis-Weblog in Autorennetzwerk buecherbrett.org
- Datenschutzerklärung
- carpe librum (Rezensionen)
- Literaturwelt
- Orhan Pamuk, Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2005 – Suche hier im Blog
- Interview mit Bastian ‚Dativ‘ Sick
